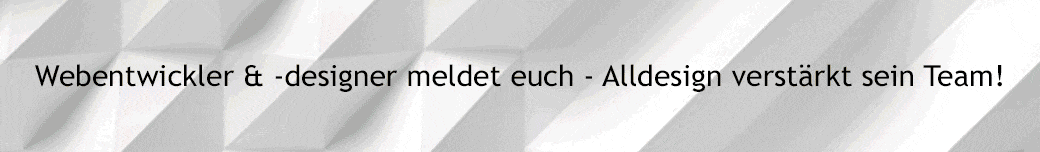Wie viele Passwörter muss man sich als ’normaler‘ Mensch (ich zumindest halte mich für einen solchen) eigentlich merken können? Oder sollte ich mir besser die Frage stellen, wo ich den verflixten Zettel mit dem neuen bzw. geänderten Passwort schon wieder hingetan habe?
Früher war es ja nur die PIN der Bankkarte und das Fahrradschloss mit seinen vier Zahlen, die es sich zu merken galt. Doch heute werde ich fast täglich gebeten, mein persönliches, streng geheimes Passwort einzugeben oder mir ein neues einfallen zu lassen, weil das eingegebene falsch war. Hieß mein Passwort (im folgenden PW genannt) für mein Amazon Konto nun ‚NRW§$%&yx√2021.6′ oder war ich schon bei der geänderten Version ´NRW§$%&yx√2021.7‘? Irgendwo hatte ich es mir doch aufgeschrieben …
Wenn man den schlauen Tipps im Netz zur Findung eines sicheren PWs folgt, sollte man dieses sofort notieren und auch behalten, wo man diese Notiz aufbewahrt. Außerdem sollte man bei vollem Verstand sein – sonst geht’s garantiert daneben. Das PW sollte mindestens 12 Zeichen umfassen, davon ein Mix aus Klein- und Großbuchstaben, außerdem sollten Ziffern und Sonderzeichen darin vorkommen. Um es sich leichter merken zu können, sollte es mit Hilfe von eingängigen Akronymen gebildet werden, die man untereinander in der Reihenfolge tauscht oder verschachtelt. So könnte ein PW auf der Grundlage des Konfuzius Zitates „Keine Reise ist zu lang mit einem Freund an der Seite“ z. B. wie folgt lauten: ‚kRiuZl√mEfaDs1963′. Hoffentlich honoriert der PW Generator der entsprechenden Website dieses als ’sicheres Passwort‘ und vergibt fünf von sechs grünen Sternchen (den sechsten Stern gibt es erst bei Verwendung verschiedener Schriftarten oder kyrillischen Schriftzeichen). Wie könnte man so was vergessen?! Wenn Sie jetzt am Bahnsteig vor dem Fahrkartenautomat oder bei Lidl an der Kasse stehen, um Ihr Handy mit diesem Da Vinci Code freischalten wollen, sollten Sie die Leute vorlassen oder stattdessen genügend Bargeld mit sich führen. Andernfalls schafft man sich Feinde, verpasst den Zug oder geht mit leerem Einkaufswagen raus.
Ähnliches Unbehagen widerfährt mir bei Spracherkennungs-Assistenten. Zum Glück bin ich morgens in der Küche alleine, wenn ich noch schlaftrunken zwischen Espresso-Automat und geöffneter Kühlschranktür mit ‚Siri‘ oder ‚Hey Google‘ kommuniziere. Auch wenn ich dreimal höflich darum gebeten habe, Radio 1Life abzuspielen, bin ich irgendwann schon zufrieden, zumindest eine niederländische Interpretation von Gustav Mahlers 5. Sinfonie zu hören. Noch ungehorsamer ist die Spracherkennung im Auto. Da ich in der Regel ja die grobe Richtung meines Zieles kenne und schon mal losfahre, verbringe ich oft mehrere Kilometer mit langsamen, deutlich akzentuierten Sprachwiederholungen des gewünschten Zielortes, als säße ich beim Logopäden. Entweder nervt die Stimme im Navi mit „Kannst du das bitte wiederholen!“ oder macht mir Vorschläge zu meinem gewünschten Ziel auf einem Verkehrsübungsplatz in Wangerooge.
Die moderne Technik bietet schon eine Menge an raffinierten Erleichterungen im Alltag, vorausgesetzt sie funktioniert und man beherrscht sie auch. Meine Kinder belächeln mich des Öfteren als Techniktrottel, wenn ich versuche, bei YouTube Musik über diverse Lautsprecher in der Wohnung abzuspielen. Wenn es dann aber heißt „Opa, könntest du vielleicht das Fahrrad flicken oder den großen Spiegel aufhängen?“, dann ist wieder alles im Lot. Dafür gibt es nämlich keine App und Siri würde dich nur blöde angucken, hätte sie denn Augen. Auf solche Fragen antwortet sie: „Hmm, gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann?“ Und glaube ja nicht, da wäre irgendwo eine Spur von Verlegenheit oder so was zu hören!
Ich freue mich jedenfalls, mit meinem iPhone telefonieren zu können, die Uhrzeit abzulesen und lustige Bildchen von meinen drei Enkeln zu sehen. Die anderen 500 Funktionen überlasse ich denen, die meinen, sie zu brauchen.
Ihr Gregor Kelzenberg